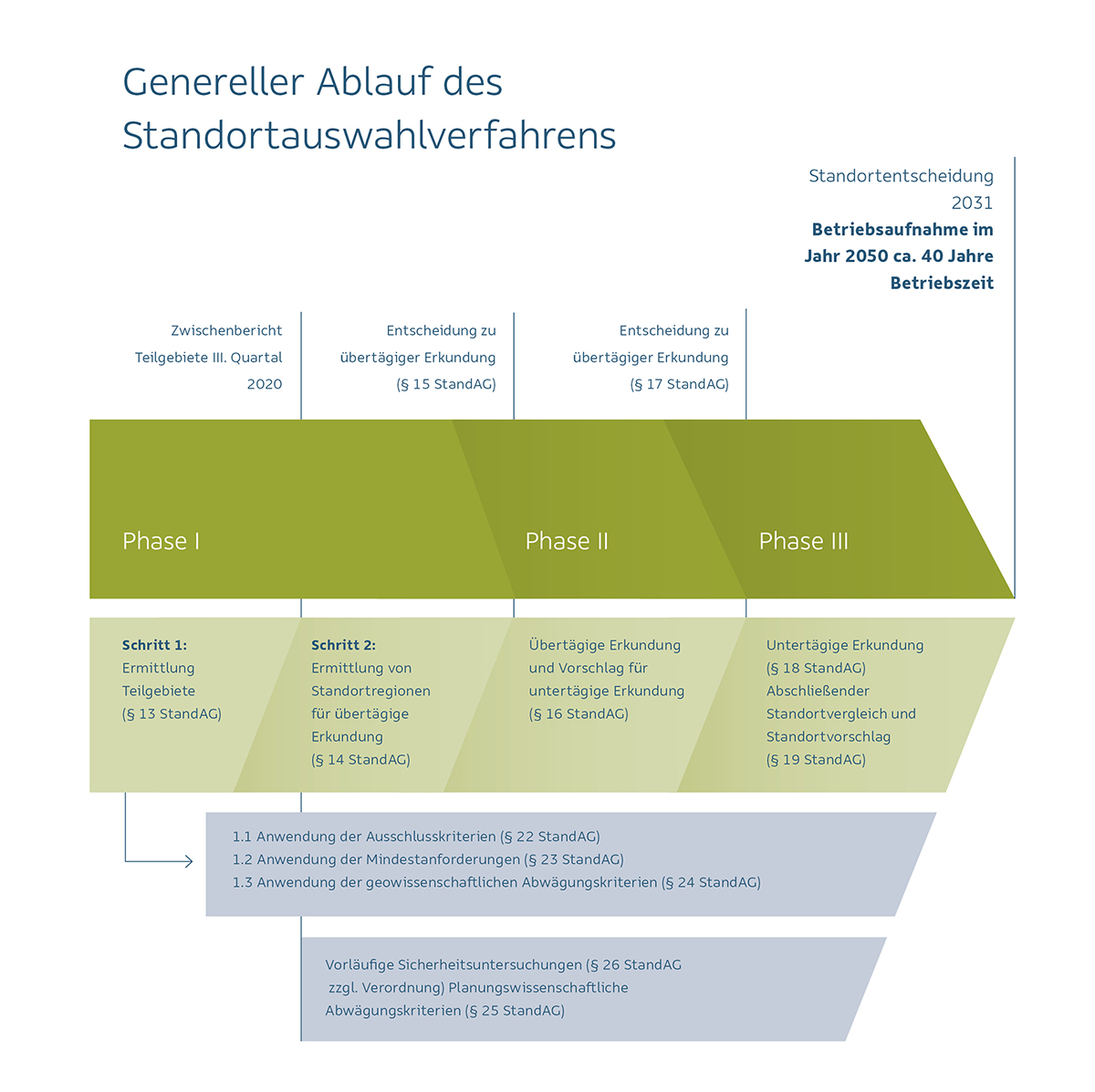Wie innovativ ist das Standortauswahlgesetz?
19.11.2020 Hintergrund
apl. Prof. Dr. Ulrich Smeddinck hat den ersten Rechtskommentar zum Standortauswahlgesetz herausgegeben. Er war als Co-Sprecher am Forschungsverbund Forschungsverbund ENTRIA (externer Link) beteiligt und arbeitet nun auch im Folgeprojekt TRANSENS (Transdisziplinäre Forschung zur Entsorgung hochradioaktiver Abfälle in Deutschland) (externer Link) mit. Er leitet das Teilprojekt DIPRO (Dialog und Prozessgestaltung in Wechselwirkung von Recht, Gerechtigkeit und Governance) (externer Link). Er arbeitet am Institut für Technofolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) (externer Link) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Wie innovativ ist das Standortauswahlgesetz?
apl. Prof. Dr. Ulrich Smeddinck, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS).
Neustart oder unbelehrbares Regierungshandeln?
Kann ein Gesetz mit einem fortschrittlichen Regelungsdesign innovativ sein, obwohl es mehr oder weniger im klassischen Gesetzgebungsverfahren verabschiedet wurde? Die Politik lobte das Standortauswahlgesetz als Neustart. Zum einen trat ein aufwendiges, innovatives Zulassungsverfahren an die Stelle des herkömmlichen Planfeststellungsverfahrens.Damit berücksichtigte der Gesetzgeber die Erfahrungen mit dem Tiefbahnhofsprojekt Stuttgart 21 wie Vorschläge des AK End aus dem Jahr 2004. Stolz war man auf den, über die alten Parteigräben hinweg gefundenen Kompromiss. Nur die Linke scherte aus. Kritiker aus der Gesellschaft waren enttäuscht, dass sie nicht mehr und stärker einbezogen wurden. Der Vorwurf lautete, der Staat habe nichts dazugelernt.
Allerdings bekennt sich der Gesetzgeber in § 1 zu einem insbesondere lernenden und selbsthinterfragenden Standortauswahlverfahren. Und tatsächlich war der Gesetzestext von 2013 nicht das letzte Wort. Das Gesetz wurde im Anschluss an die Beratungen der Endlagerkommission – und damit unter Beteiligung und Einfluss gesellschaftlicher Akteure – maßgeblich fortentwickelt. Forderungen, die Öffentlichkeitsbeteiligung nachvollziehbar zu regeln, wurden befolgt. Der Gesetzgeber bekennt sich zu einem dialogorientierten Prozess der Beteiligung. So etwas gab es noch nicht: Das erfordert, nicht allein strategisch und zielorientiert in eine Richtung zu kommunizieren und zu überzeugen, sondern vor allem auch zuzuhören und bereit zu sein, sich überzeugen zu lassen – für die staatliche Seite im Standortauswahlverfahren eine immense Herausforderung. Zudem ist die Geeignetheit der Beteiligungsformen in angemessenen, zeitlichen Abständen zu prüfen.
Zwischen Konsens und Konflikt
Mehr Partizipation, weniger Rechtskontrolle
Das Standortauswahlgesetz legt den Schwerpunkt in der Konfliktbearbeitung und -lösung auf partizipative Formen der Verständigung. Demgegenüber wird der Rechtsschutz einerseits eingeschränkt: Für die Kontrolle des Verfahrens auf Rechtsfehler ist das Bundesverwaltungsgericht die Eingangsinstanz. Andererseits wird zugleich der Kreis der Klageberechtigten ausgeweitet. Es sind jetzt auch Personen klageberechtigt, die früher nicht klagen durften. Also: mehr Bürgerbeteiligung, weniger Rechtsschutz?
Typischerweise werden umstrittene Großprojekte über viele Jahre durch die Instanzen vor Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht angegriffen, ehe ohnehin das Bundesverwaltungsgericht angerufen wird. Wichtiger aber ist, dass in der Rechtswissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten die Überzeugung gewachsen ist, dass es sich lohnt, die Möglichkeiten zur Konfliktbewältigungim Vorfeld von Gerichtsprozessen zu nutzen. Der Konfliktstoff kann umfassender beraten werden. Mehr Beteiligte können in die Lösungssuche einbezogen werden. In Prozessen wird dagegen nur zwischen Kläger und beklagtem Staat über zwei, drei oder mehr Rechtsfehler entschieden. Der Gesetzgeber versucht, diese Potentiale zur Verständigung zu heben, ohne den notwendigen Rechtsschutz abzuschaffen: Ziel der Öffentlichkeitsbeteiligung ist eine Lösung zu finden, die in einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen wird und damit auch von den Betroffenen toleriert werden kann. Neuartig – und ein gewisser Ausgleich – ist im Detail etwa das Nachprüfungsrecht für Regionalkonferenzen nach § 10 Absatz 5 Satz 1. Die Regionalkonferenzen werden gebildet, sobald sich die Endlagersuche auf einige Standortregionen eingeengt hat.
Zwischen Vertrauen und Misstrauen: das Nationale Begleitgremium
Die vielleicht markanteste Innovation im Standortauswahlgesetz ist – der Grundform nach bereits seit 2013 – das Nationale Begleitgremium. Den klassischen Akteuren, Vorhabenbetreiber und Kontrollbehörde ist ein dritter Player an die Seite gestellt: ein „Wachhund” als Stellvertreter der Gesellschaft. Aufgabe des pluralistisch zusammengesetzten Nationalen Begleitgremiums ist die vermittelnde und unabhängige Begleitung des Standortauswahlverfahrens, insbesondere der Öffentlichkeitsbeteiligung, mit dem Ziel, so Vertrauen in die Verfahrensdurchführung zu ermöglichen. Das Umschlagen von Vertrauen in Misstrauen und das allmähliche Aufkommen von Vertrauen bei gleichzeitigem Verblassen des Misstrauens ist eine Phänomenologie, die im Standortauswahlverfahren eine große Rolle spielt. Viele haben die Auseinandersetzung über die friedliche Nutzung der Kernenergie als Vertrauensverlust erlebt und reagieren entsprechend gallig auf die Aufforderung, zu vertrauen. Sie sind misstrauisch. Aber Vertrauen ist auch kein Wert oder Leitziel, das ohne Konkurrenz ist. In der Demokratie-Theorie (zum Beispiel von Pierre Rosanvallon) wird sehr wohl auch der Wert des Misstrauens für eine gute Entwicklung des Gemeinwesens hervorgehoben. Aus diesem Geiste heraus ist auch das Begleitgremium geboren. Es soll nicht vertrauensselig Aktivitäten und Vorschlägen der anderen Akteure folgen – sie abnicken –, sondern Schwächen und Fehler aufdecken. Wenn diese Aufgabe überzeugend erledigt wird, dann – so demütig formuliert der Gesetzgeber – könnte das Vertrauen in das Standortauswahlverfahren wachsen.
Nicht perfekt, aber glücklich?
Partizipativ, wissenschaftsbasiert, transparent, selbsthinterfragend und lernend soll das Standortauswahlverfahren sein – manche, wie Eckhard Rehbinder, nennen das vollmundig. Typisch ist, dass der Gesetzgeber nicht allen Leitwerten, die er zu Beginn eines Gesetzes herausstellt, zu 100 Prozent gerecht werden kann. Sind doch alle Vorschriften Produkte von Kompromissen im politischen Prozess. Maß und Mitte, von allem ein bisschen – das kann der demokratische Gesetzgeber einlösen. Viele Fachleute für bestimmte Themen und Kompetenzen enttäuscht das. Ob die Politik sich noch einmal zu signifikanten Änderungen des Gesetzes aufraffen kann, ist völlig offen.
Keine Frage ist, dass das Standortauswahlgesetz im Lichte fortschrittlicher umweltrechtlicher Regulierung innovativ ist. Eine offene Frage ist dagegen: Kann man vielleicht – wie im echten Leben auch – mit jemandem gut zusammenarbeiten, gute Ergebnisse erzielen, womöglich glücklich werden, ohne dass diese Person (das Gesetz) in allen Punkten perfekt ist?