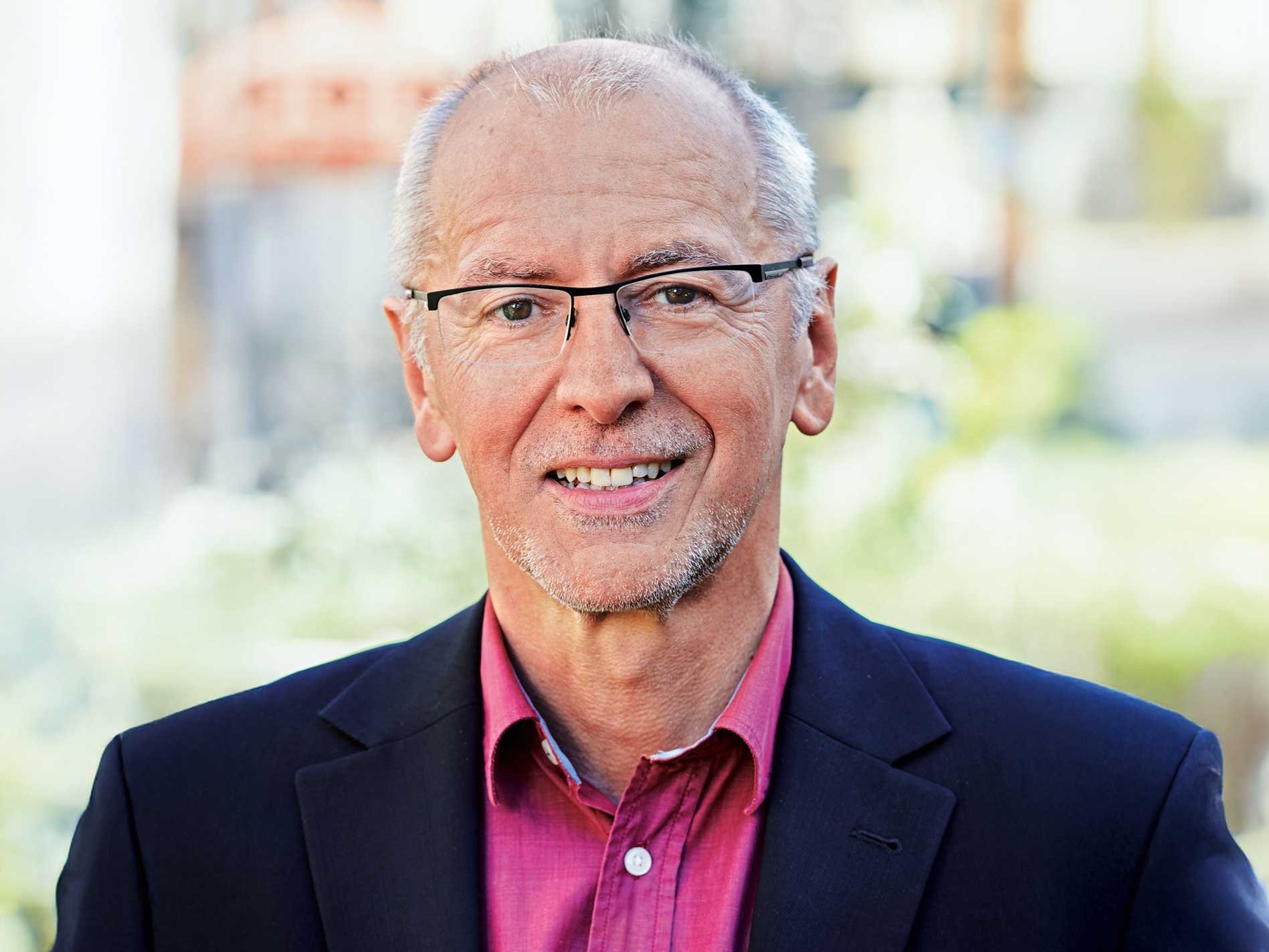Zeit gewinnen?
Endlagersuche
20.11.2025 Reaktionen
ADie Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle ist ein Generationenprojekt, das im gesellschaftlichen Konsens gelingen muss. Gleichzeitig ist klar, dass dieser Prozess in seiner aktuellen Form noch lange dauern wird. Für viele beteiligte Akteure: zu lange. Wie kann es schneller gehen und was muss dabei beachtet werden? Wir haben einige Stimmen zu dieser Frage gesammelt.
„Ein lernendes Verfahren“
Christian Kühn ist Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE). Er plädiert für eine Verfahrensbeschleunigung, weil sie die Akzeptanz in der Bevölkerung stärkt.

Die Suche nach dem Atommüllendlager darf nicht noch mehrere Jahrzehnte dauern. Denn Umfragen des BASE zeigen: Schon jenseits der 2040er-Jahre sinkt die öffentliche Akzeptanz für das durch das Standortauswahlgesetz (StandAG) definierte Verfahren. Außerdem können wir es uns in einer zunehmend unsichereren Welt nicht leisten, die Suche künftigen Generationen aufzubürden. Darum brauchen wir im Verfahren mehr Tempo. Schon in der vergangenen Legislaturperiode forderte die damalige Bundesumweltministerin Steffi Lemke, sich bis spätestens Mitte des Jahrhunderts auf einen Standort festzulegen. Auch ihr Nachfolger Carsten Schneider pocht auf Beschleunigung. Potenzial sehen wir beim BASE unter anderem bei der Optimierung von Betretungs- und Erkundungsrechten. Und durch die Zusammenlegung der über- und untertägigen Erkundung ließe sich das Verfahren sogar um mindestens ein Jahrzehnt verkürzen.
Aber warum den Prozess ändern, der vor zehn Jahren vom Bundestag beschlossen wurde? Weil wir heute ein deutlich klareres Bild von der Endlagersuche haben als bei der Verabschiedung des StandAG. Erfahrungen aus der Schweiz zeigen, dass man dank moderner Erkundungs- und Bohrtechniken auf den Bau von Erkundungsbergwerken verzichten kann – bei qualitativ gleichwertigen Ergebnissen. Und das StandAG schreibt sogar ein lernendes Verfahren vor. Deshalb ist es nur folgerichtig, den neuesten Stand an Wissenschaft und Technik zu berücksichtigen und ernsthaft darüber zu diskutieren.
Unsere oberste Prämisse lautet: keine Abstriche bei den Grundprinzipien des StandAG – Transparenz, Sicherheit, Dialog und Lernbereitschaft. Die Straffung des Ablaufs würde die öffentliche Teilhabe sogar stärken: Die Endlagersuche ist der größte und längste Beteiligungsprozess, den die Bundesrepublik Deutschland je gesehen hat. Und wer sich engagiert, sollte den Erfolg seines Engagements auch erleben. Ein endloses Verfahren würde diese Aussicht gefährden – und damit am Ende die Akzeptanz für das deutsche Endlager.
„Keine Beschleunigung um der Beschleunigung willen“
Bernd Redecker ist Sprecher des Bundesarbeitskreises Atomenergie und Strahlenschutz beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Weniger Beteiligung der Öffentlichkeit an der Standortsuche für ein Endlager lehnt der Umweltwissenschaftler ab.
Warum jetzt eine Beschleunigung der Standortsuche gefordert wird, erschließt sich mir nicht. Im internationalen Vergleich ist Deutschland gar nicht so langsam. Fachwissenschaftler*innen haben von Beginn an mit einem langen Verfahren gerechnet. Grundsätzlich haben wir vom BUND nichts gegen eine Beschleunigung – sofern sie zu gleichen oder besseren Sicherheitsstandards führt. Darauf geht die BGE bei der vorgeschlagenen Zusammenlegung der Phasen II und III bislang nicht ein.
Beschleunigung nur um der Beschleunigung willen lehnen wir ab. Kritisch sehen wir auch alle Vorschläge, die die Beteiligung der Öffentlichkeit verkürzen. Schon zu Beginn von Phase I hätte die Öffentlichkeit mehr Zeit gebraucht, um sich in die komplexe Materie einzuarbeiten und fundierte Stellungnahmen abzugeben. Wenn Phase II und III zusammengelegt werden, fällt einer dieser Zwischenschritte komplett weg. Dabei fördern sie Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ermöglichen frühzeitig sinnvolle Korrekturen. Möglichkeiten zur korrektiven Einflussnahme würden sonst weit nach hinten geschoben. Das untergräbt Vertrauen und es könnte schnell der Eindruck politischer Einflussnahme auf die Standortsuche entstehen.
Auch das Argument, dass ein früheres Endlager mehr Sicherheit bringe, überzeugt uns nicht. Entscheidend ist ein tragfähiges Konzept auch für die Zwischenlager – unabhängig davon, ob ein Standort für ein Endlager 20 Jahre früher oder später gefunden wird. Denn der Müll wird noch lange zwischengelagert werden müssen. Aber die Zwischenlager sind nur auf 40 Jahre ausgelegt. Diese Frist läuft in Gorleben und Ahaus bald ab – hier besteht akuter Handlungsbedarf.

„Wir müssen schneller zu Potte kommen“
Josef Klaus ist Bürgermeister der Gemeinde Niederaichbach. Im dortigen Zwischenlager befinden sich Brennstäbe aus den stillgelegten Atomkraftwerken Isar I und II sowie Castorbehälter mit verglasten Abfällen aus der Wiederaufbereitung von Brennelementen.

Für mich ist die Endlagersuche ein trauriges Kapitel: Mir erschienen schon die ursprünglichen Planungen – die Festlegung auf einen Standort bis 2031 und ein Endlager dann vielleicht erst nach 2050 – als sehr lang. Und nun soll es bis 2070 oder noch länger dauern? Wenn ich höre, dass es beim Endlager Konrad für schwach- und mittelradioaktive Abfälle Verzögerungen geben wird, frage ich mich: Wie wollen wir es schaffen, hochbelastetes Material einzulagern?
In Deutschland denken viele Menschen im Zusammenhang mit Atomenergie gleich an Tschernobyl oder Fukushima. Deshalb haben viele Menschen auch Angst vor einem Endlager. Dabei geht von Atommüll, wenn er 500 Meter tief unter der Erde gelagert wird, keine Gefahr mehr aus. Die aktuell oberirdische Lagerung birgt hingegen Unsicherheiten: Die Genehmigungen der Zwischenlager laufen in wenigen Jahren aus – auch wenn sie damit nicht gleich technisch unsicher werden. Doch schon jetzt befürchten Menschen, mit denen ich spreche, dass unser Zwischenlager in einem möglichen Krieg angegriffen werden könnte. Zudem weiß niemand, wie sich die politischen Verhältnisse in Deutschland entwickeln und wie Wahlen in der Zukunft ausgehen werden.
Kurzum: Wir müssen schneller zu Potte kommen. Über Jahrzehnte weiterzusuchen, bis man den bestmöglichen Standort findet, finde ich nicht richtig. Mir reicht ein möglicher guter Standort. Deshalb begrüße ich den Vorschlag der BGE, die Endlagersuche zu beschleunigen – auch wenn so die Beteiligung der Öffentlichkeit vielleicht weniger intensiv ausfällt. Außerdem: Zu glauben, dass die Menschen, bei denen das Endlager entstehen soll, zufrieden sind, weil sie beteiligt wurden, ist ein Trugschluss. Die betroffene Region muss aber einen wirtschaftlichen Ausgleich bekommen. Da muss Geld fließen.
„Beschleunigung – aber mit Augenmaß“
Prof. Dr. Armin Grunwald ist Leiter des Büros für Technikfolgen Abschätzung beim Deutschen Bundestag, ehemaliges Mitglied der Endlagerkommission und Co-Vorsitzender des Nationalen Begleitgremiums (NBG).
Auch das Nationale Begleitgremium (NBG) sieht die Notwendigkeit, die Endlagersuche zu beschleunigen, damit spätestens zur Mitte des Jahrhunderts ein Standort feststeht. Entscheidend ist jedoch, dass die Grundprinzipien des Standortauswahlgesetzes (StandAG) gewahrt bleiben: Beteiligungsorientierung, Transparenz, wissenschaftliche Gründlichkeit und ein lernendes Verfahren.
Die Lehren aus Gorleben zeigen: Wo Transparenz und Beteiligung fehlen, verliert ein Verfahren seine Legitimation. Genau deshalb darf es keinen „dirty shortcut“ geben – keine Beschleunigung um jeden Preis. Beteiligung kostet zwar Zeit und Ressourcen, sie erhöht aber nachweislich die Qualität des Prozesses. In einer politischen Stimmung, die überall nach Beschleunigung ruft, besteht die reale Gefahr, dass Beteiligung reduziert wird, um Zeit zu sparen. Genau das würde Misstrauen erzeugen. Hinzu kommt: Die Diskussionen über Beschleunigung finden bislang fast ausschließlich in den zuständigen Institutionen statt – nicht in der Öffentlichkeit. Würden Beschleunigungsentscheidungen dort vorbereitet und dann überraschend verkündet, könnte leicht der Eindruck entstehen, etwas werde „politisch durchgedrückt“. Das NBG fordert daher eine offene und öffentliche Debatte über mögliche Änderungen und einen transparenten Zeitplan, der zwar nicht präzise voraussagen kann, wann ein Standortentscheid fällt, aber Orientierung gibt und Fortschritte wie Verzögerungen nachvollziehbar macht.
Beschleunigungspotenziale sieht das NBG durchaus: durch parallele Arbeitsschritte, optimierte Betretungsrechte und moderne Erkundungsmethoden. No-Gos sind Abstriche bei Sicherheit – auch der Zwischenlager –, bei Transparenz und bei wissenschaftlicher Fundierung. Qualität braucht Zeit. Wer hier vorschnell handelt, riskiert einen Rückfall in alte Fehler und gefährdet das Vertrauen in den Standortauswahlprozess für ein Endlager.